
Spotify Killed The Radio Star: Wie Algorithmen unsere Musik bestimmen
Früher haben wir Radio gehört und Mixtapes selbst zusammengestellt, heute lassen wir uns die Musik bequem vom Streamingdienst vorschlagen. Wie verändert sich unser Hörverhalten, wenn die Musikvorschläge zunehmend algorithmenbasiert sind?
Vorbei sind die Zeiten, als wir unsere neuen Lieblingslieder im Radio entdeckten oder ein liebevoll kuratiertes Mixtape in den Händen hielten. Immer mehr unseres Musikkonsums spielt sich auf Streamingdiensten ab, und wird durch KI-getriebene Empfehlungen bestimmt. Algorithmen ersetzen Radio-DJs, und das Ritual der musikalischen Neuentdeckungen ist sorgfältig verpackt in eine wöchentliche 30-Lieder-Playlist. Laut Spotify wird ein Drittel aller neu entdeckten Künstler:innen über die «Für dich erstellt»-Empfehlungen gefunden. Denn wie in so vielen Branchen gilt auch in der Musikindustrie: Personalisierung ist alles.
Wie der Spotify-Algorithmus funktioniert
Spotify verrät nicht im Detail, wie sein Algorithmus funktioniert. Klar ist aber, dass drei Komponenten wichtig sind, um dir passende Lieder vorzuschlagen:
- Was ist es für ein Lied? (Content-basierte Analyse)
- Wie verhalten sich Nutzer:innen mit ähnlichem Geschmack? (kollaborative Analyse)
- Was genau hörst du, und wie? (personalisierte Verhaltensanalyse)
Content-basierte Analyse
Hier geht es um den Song an sich: Welcher Stil hat er? Zu welcher Stimmung passt er? Ziel ist, zu beschreiben, wie der Song klingt und was ihn ausmacht.
Spotify greift dafür auf Metadaten zurück, die von den Künstler:innen selbst stammen – etwa Titel, Mitwirkende, Genre, Sprache und verwendete Instrumente. Zusätzlich «hört» sich Spotify das Lied an – heisst: ein Algorithmus analysiert das Audiosignal und bewertet es mit Merkmalen wie Tanzbarkeit, Intensität und emotionale Färbung. Auch der Liedtext, Musikblogs und usergenerierte Playlists liefern Hinweise: Taucht ein Song beispielsweise häufig in Playlists mit «traurig» im Titel auf, dann ist er wahrscheinlich genau das.

Kollaborative Analyse
Das Herzstück des Spotify-Algorithmus: Er setzt die Lieder zueinander in Kontext. Wenn zwei Personen sowohl Songs A und B mögen, dann gefällt der ersten vermutlich auch Lied C, das die zweite Person mag. Da Musikgeschmack aber meist vielfältig ist, konzentriert sich Spotify vor allem auf Playlists von Nutzer:innen. Wenn zwei Songs oft in denselben Playlists vorkommen, gelten sie als ähnlich.
Personalisierte Verhaltensanalyse
Spotify weiss nun, wie das Lied klingt und in welchem Verhältnis es zu anderen Liedern steht. Fehlt nur noch die Frage, ob es auch zu dir passt.
Dazu analysiert Spotify dein Verhalten auf der Plattform; unter anderem, was du in deiner Bibliothek speicherst, was du zu Playlists hinzufügst, welche Profile von Musiker:innen du dir anschaust, wem du folgst und was du teilst. Zusätzlich fliesst dein Hörverhalten in den Algorithmus ein, sprich: wie lange du Songs laufen lässt, welche du wiederholt abspielst und wie lange am Stück du Musik hörst.
Musikempfehlungen – auf dich zugeschnitten
So entstehen Empfehlungen, die im besten Fall genau das enthalten, was du als Nächstes hören willst. Von wöchentlichen Neuentdeckungen, die zu deinem Musikgeschmack passen, über personalisierte Playlists zum Sportmachen, Lernen, Kochen oder Feiern, bis hin zur «Daylist», die dir alle paar Stunden Vorschläge macht, die genau zu deiner Stimmung und aktuellen Tageszeit passen.
Personalisierung ist praktisch: Wir erhalten, was uns gefällt. Doch was macht es mit uns, wenn wir vorwiegend automatisch generierte statt menschlich kuratierte Musikvorschläge hören?
Willkommen in deiner Filterbubble
Hast du auch manchmal das Gefühl, dass sich all deine «Für dich erstellt»-Playlists irgendwie gleich anhören? Sie tragen unterschiedliche Titel, haben verschiedene Zwecke, aber bieten eigentlich nur verschiedene Varianten des gleichen Sounds.
Jetzt, da wir wissen, wie der Spotify-Algorithmus funktioniert, ist auch klar, warum das so ist: Algorithmen liefern das, was wir wollen – oder zu wollen scheinen. Doch was wir wollen, hängt auch davon ab, womit wir überhaupt in Kontakt kommen.
Statt unseren Musikgeschmack herauszufordern, liefern Algorithmen neu gemixte Versionen dessen, was uns schon gefällt. So bewegen wir uns in unserem eigenen kleinen Musikuniversum. Und solange wir nicht aktiv versuchen, daraus auszubrechen, entgehen uns Songs, die uns vielleicht gefallen würden, die aber zu weit von unserem bisherigen Geschmack entfernt sind.
Eine Spotify-eigene Analyse bestätigt das: Wer mehr auf algorithmische Empfehlungen setzt, hat ein weniger vielfältiges Hörprofil. Wer hingegen beginnt, seinen musikalischen Horizont zu erweitern, hört häufiger Musik, die von Menschen kuratiert wurde.
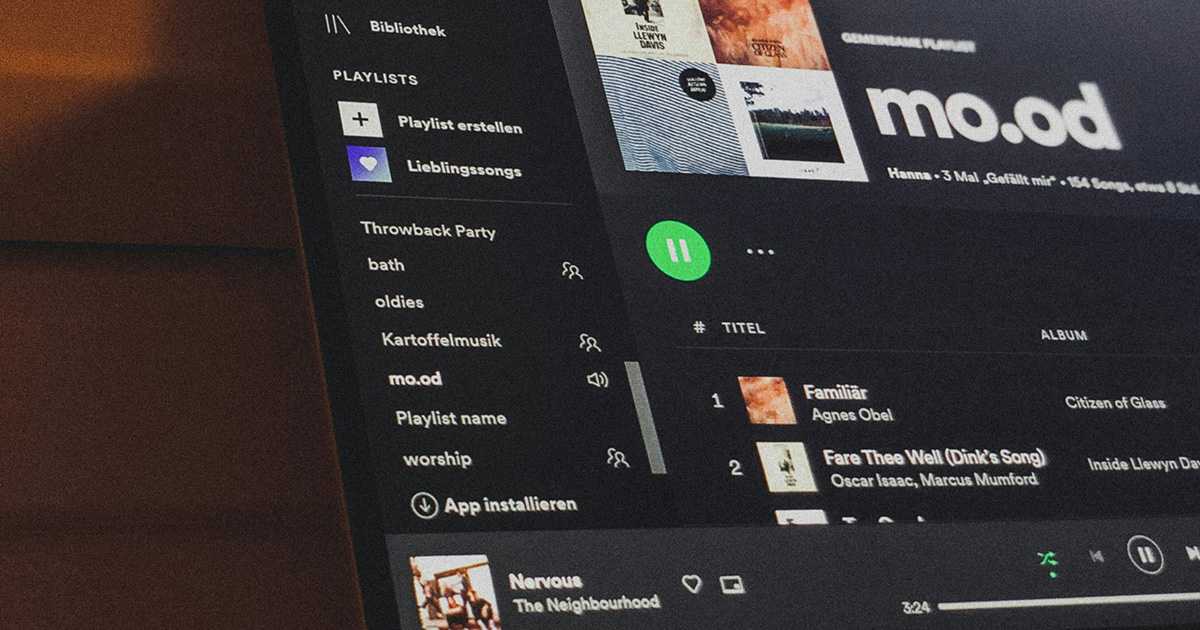
Ungleich gehört
Wie Spotify Musik kategorisiert, bestimmt mit, welche Songs überhaupt sichtbar sind. Und dabei gilt: Verzerrungen sind nicht ausgeschlossen. Studien zeigen, dass Empfehlungssysteme oft bestimmten Gruppen gegenüber unfair sind. Künstlerinnen sind etwa in Charts und bei Musikpreisen unterrepräsentiert. Und diese Ungleichheit spiegelt sich auch auf Streamingdiensten wider.
Hinzu kommt ein sich selbst verstärkender Kreislauf: der sogenannte Feedback-Loop. Was empfohlen wird, wird mehr gehört – und was mehr gehört wird, wird noch öfter empfohlen. Die Folge: Die Grossen werden grösser, während kleinere und unbekannte Künstler:innen es schwerer haben.
Keep it short
Die Logik der Streamingdienste verändert nicht nur, was wir hören, sondern auch, wie Musik gemacht wird. Seit Jahren werden Songs immer kürzer. In den aktuellen Spotify-Charts liegen die meisten bei etwa drei Minuten. Das liegt unter anderem daran, dass ein Lied bessere Chancen hat, auf eine Playlist zu kommen, wenn es bis zum Ende gehört wird. Und Playlists sind das wichtigste Schaufenster für neue Musik.
Warum Songs immer kürzer werden
Auch das Bezahlsystem der Streamingdienste führt zu kürzeren Songs. Spotify und Co. zahlen pro Stream, unabhängig von der Länge des Liedes – vorausgesetzt es werden mehr als 30 Sekunden abgespielt. Heisst: Musiker:innen komponieren so, dass wir mindestens 31 Sekunden dranbleiben. Und warum ein sechsminütiges Stück schreiben, wenn ein zwei Minuten langer Track in der gleichen Zeit die dreifachen Streams erreicht?
Der emotionale Wert
Neben den messbaren Effekten geht es auch um etwas weniger Greifbares: ein Gefühl. Bevor es Streaming gab, steckte hinter musikalischen Neuentdeckungen zwar mehr Arbeit, aber auch echte Belohnung. Die Freude war riesig, wenn man ein neues Lieblingslied fand und es stolz im Freundeskreis teilen konnte.
Musik von Hand zusammenzustellen hat eine tiefere Bedeutung. Wenn ein:e Künstler:in ein Album veröffentlicht, ist die Reihenfolge der Lieder meist sorgfältig gewählt. Sie erzählt eine Geschichte und transportiert eine Stimmung. Ähnlich bei selbstgemachten Playlists oder Mixtapes; auch da steckt oft mehr dahinter als nur Musik. Es ist eine Form von Ausdruck, fast schon eine kleine Kunst, die durch algorithmenbasierte Empfehlungen verloren geht.

Auf zu neuen Ufern
Spannenderweise profitiert auch Spotify davon, wenn wir unseren Musikgeschmack erweitern. In seiner eigenen Studie fand das Unternehmen heraus: Ein vielfältiger Musikgeschmack bedeutet auch, dass Nutzer:innen eher ein Premium-Abo haben und langfristig auf der Plattform bleiben.
Aus Unternehmenssicht wäre es also sinnvoll, uns den Weg aus der Algorithmus-Bubble zu erleichtern. Bis das passiert, kannst du selbst aktiv werden. Hier ein paar Ideen, wie du dem Algorithmus gelegentlich entkommst:
- Kuratierte Playlists nutzen: Hör dich durch Playlists, die von Spotify-Redakteur:innen oder anderen Nutzer:innen erstellt wurden. Aktuell gibt es jedoch keine gezielte Suchfunktion für usergenerierte Playlists – falls du einen Trick kennst, ab in die Kommentare damit.
- Eigene Playlists erstellen und teilen: Stell selbst Musik zusammen, teile sie im Freundeskreis oder erstellt gemeinsam Playlists. So entsteht ein persönlicherer Musikfluss, ganz ohne Algorithmen.
- Gemeinsamer Mix mit Freund:innen: Spotify bietet eine Funktion, bei der eine Playlist aus dem Musikgeschmack mehrerer Personen generiert wird. Der Algorithmus arbeitet zwar mit, aber auf der Basis mehrerer Geschmäcker. Das erweitert deinen Horizont ganz automatisch.
- Music League spielen: Eine Online-Challenge, bei der Spieler:innen Songs zu einem bestimmten Thema einreichen. Daraus entsteht eine Playlist, die von allen gehört und bewertet wird. Ideal, um ausserhalb der eigenen Bubble auf neue Musik zu stossen.
- Unchartify entdecken: Die Plattform bietet dir den gesamten Spotify-Katalog, ohne dass dieser nach deinen Vorlieben geordnet ist. Stattdessen wird nach Genre in alphabetischer Reihenfolge sortiert. Zusätzlich ist jedes Album und jede:r Künstler:in mit ähnlichen Alben bzw. Künstler:innen verknüpft.
Fazit: Raus aus dem Einheitsklang
Noch nie war so viel Musik so leicht zugänglich. Und trotzdem klingt unser persönlicher Soundtrack oft erstaunlich gleichförmig. Algorithmen liefern zuverlässig, was wir mögen, aber eben auch immer wieder dasselbe. Eine Möglichkeit daraus auszubrechen? Bewusster hinhören, sich mit anderen vernetzen und ab und zu über den eigenen musikalischen Tellerrand schauen.
Quelle Titelbild: Unsplash | Ivana Cajina
Marketing Manager Editorial Content
Ich liebe es, in andere Welten einzutauchen, sei es durch spannende Geschichten, mit Reisen in ferne Länder und Kulturen oder in meinem eigenen kleinen Garten – ich bin immer auf Entdeckungsreise. Und wenn es Zeit wird, die Seele baumeln zu lassen, findet ihr mich auf der Yogamatte oder mit einem guten Buch in der Hand.
Alle Beiträge der Autorin anzeigenWeitere Beiträge entdecken

Spotify Jams: Hier spielt die Musik!
Kennsch das? Du hängst mit Kolleg:innen rum und nach jedem dritten Song will jemand sein Handy verbinden oder schickt dir einen Track-Link, den du bitte laufen lassen sollst? Sag einfach «nein, aber» und bringe das Zusammensein in Einklang – selbst wenn ihr nicht am selben Ort seid.
06.06.2025
Mehr lesen
Hitster: Das Spiel, das alle zum Mitsingen bringt
Keine Lust auf Brettspiel-Strategien und komplizierte Regeln? Dann könnte Hitster genau das richtige Spiel für dich sein. Es sorgt für Rätselspass gespickt mit einer Portion Nostalgie – und bringt garantiert alle zum Mitsingen. Mehr dazu im Erfahrungsbericht.
02.05.2025
Mehr lesen
Liebe geht durch die Ohren
Das warme Knistern eines Plattenspielers, gedimmtes Licht und Marvin Gaye in Höchstform. Da kommt doch direkt Stimmung auf! Erfahre in diesem Blog, wie du deine gute Stube oder noblen Schlafgemächer optisch und akustisch verzierst. So gestaltest du dein Musikerlebnis mit Niveau und Anspruch – ob für sinnliche Stunden zu zweit oder die nächste Home-Party, bleibt dir überlassen.
21.01.2025
Mehr lesen
Retro-Liebe: Warum Vergangenes plötzlich wieder cool ist
Vintage-Mode, Retro-Möbel, Sofortbildkamera oder Schallplatten – die Sehnsucht nach dem Lebensgefühl von früher ist heute so gross wie nie. Was früher als altmodisch galt, liegt plötzlich wieder im Trend. Doch was steckt dahinter?
05.06.2025
Mehr lesen




